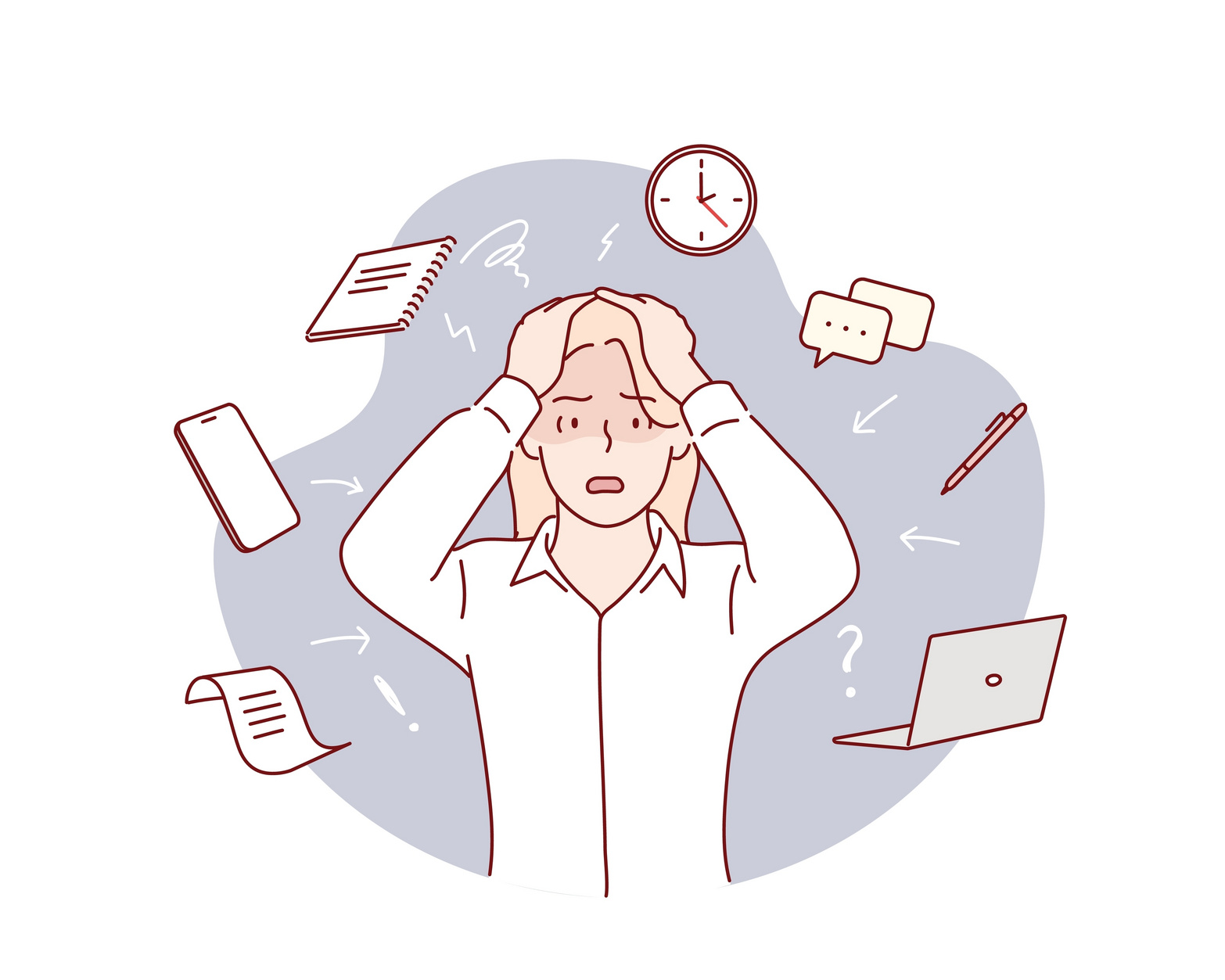Bei Aufmerksamkeitsdefizit/-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) handelt es sich um eine neurobiologische Störung, die häufig vererbt ist und bereits in der frühen Kindheit Verhaltensauffälligkeiten zeigen kann.
Sie äussert sich durch folgende Symptome:
- gesteigerte Motorik (Hyperaktivität), Hyperfokus (Abtauchen in Tätigkeit)
- eingeschränkte Durchhaltefähigkeit
- schnelle Ablenkbarkeit, Impulsivität, kaum Bedürfnisaufschub.
In der Kindheit sind 5–6 % von ADHS betroffen, dabei sind es ungefähr doppelt so viele Buben wie Mädchen. Von diesen bleiben 60–70 % auch im Erwachsenenalter symptomatisch, wobei dann die Verteilung auf die Geschlechter ausgeglichen ist.
«Sturm im Kopf», «innere Unruhe»
Es wird unterschieden zwischen primär hyperaktiv-impulsiven Menschen, primär unaufmerksamen Menschen und der gemischten Form. Erwachsene ADHS-Betroffene haben häufig ein permanent erhöhtes Spannungsniveau und bezeichnen dies auch als «Sturm im Kopf» oder auch «innere Unruhe», die aber zu keiner produktiven Aktivität führt.
In der Bevölkerung ist bisher wenig bekannt, dass ADHS und problematische Konsummuster häufig zusammen auftreten. Studien zeigen, dass Jugendliche und Erwachsene mit ADHS ein erhöhtes Risiko haben, übermässig zu konsumieren. Viele Menschen mit ADHS berichten, dass zum Beispiel Alkohol kurzfristig beruhigend und entspannend wirke, Nervosität und Unruhe abnähmen und soziale Hemmungen in den Hintergrund träten.
Erhöhtes Abhängigkeitsrisiko mit ADHS
Wer regelmässig Alkohol trinkt, verschlechtert oft seine Aufmerksamkeit und Stimmung zusätzlich. So entsteht ein Teufelskreis: Alkohol wird konsumiert, um Symptome zu dämpfen, verschärft diese aber im Nachhinein. Alkoholkonsum kann die Symptome von ADHS verschlimmern und das Risiko einer Abhängigkeit vergrössern.
Untersuchungen zeigen, dass Erwachsene mit ADHS zwei- bis dreimal häufiger alkoholabhängig werden als Menschen ohne ADHS. Das Risiko steigt besonders dann, wenn ADHS spät oder gar nicht erkannt wird. Übermässiger Alkoholkonsum kann auch die Wirksamkeit von ADHS-Medikamenten beeinträchtigen.
Es ging in der Weiterbildung um den Zusammenhang beziehungsweise die Differenzierung von Trauma-Symptomen und ADHS-Symptomen in der Suchttherapie. Unter Trauma versteht man die Folge einer Situation, in der eine Person sich extrem bedroht, hilflos oder machtlos ausgeliefert fühlt – oft verbunden mit Todesangst, Kontrollverlust oder tiefgreifender Ohnmacht. Hierbei kann es sich um ein akutes oder mehrere sich wiederholende Ereignisse handeln.
Auch in der Kindheit können dauerhaft emotionale oder körperliche Bedrohungen in wichtigen Bindungsbeziehungen – oft durch genau die Personen, von denen das Kind Schutz erwarten würde – zu einschneidenden Belastungen und tiefgreifenden Veränderungen führen, die als Bindungstraumata bezeichnet werden und häufig unerkannt bleiben.
Traumafolgestörung oder ADHS?
Menschen nach erlittenen Traumata leiden, wie auch ADHS-Betroffene, wenn auch aus anderen Gründen, unter einem erhöhten Spannungsniveau. Bei der Reaktion auf traumatische Erlebnisse kommt noch eine schnelle Übererregung («Hyperarousal») dazu, die plötzlich auftreten kann (Triggersituationen) und die Betroffenen in die emotionale Erlebniswelt der Traumasituation zurückwerfen kann («Flashback»). Daher sind auch sie vermehrt gefährdet, Alkohol zum Spannungsabbau als eine Art «Selbstmedikation» zu nutzen, um sich wieder als handlungsfähig zu erleben, mit dem Potenzial der Entwicklung einer Abhängigkeitserkrankung.
Traumafolgestörungen zählen daher auch zu den häufig zugrunde liegenden Ursachen einer Suchtkrankheit. Umgekehrt werden suchtabhängige Menschen – vor allem Frauen – häufiger Opfer psychischer oder physischer Gewalt.
Im Alltag sind Suchtberaterinnen und -berater häufig mit auffälligem Verhalten und Interaktionsschwierigkeiten der Klientinnen und Klienten konfrontiert. «Kurze Zündschnur», eingeschränkte Verlässlichkeit, schnelle Überforderung und Nähe-Distanz-Problematik können jedoch sowohl auf Abhängigkeitsstörungen als auch auf ADHS und/oder Traumafolgestörung hinweisen, mit jedoch anderer Grundproblematik und auch unterschiedlichem Behandlungsfokus. Deshalb ist es für Suchtberatende umso wichtiger, sich weiterzubilden, um ein Verständnis für diese komplexen Zusammenhänge zu entwickeln. Oft steckt hinter einer Suchterkrankung ein tieferliegendes Problem, was im Behandlungs- und Beratungsnetzwerk angemessen mitgedacht und idealerweise behandelt werden muss.
Der Substanzkonsum stellt häufig primär einen – wenn auch dysfunktionalen – Versuch dar, mit Problemen (aus welchen Gründen auch immer entstanden), zurechtzukommen. Ein alleiniger Fokus auf das Suchtmittel und dessen Abbau, ohne Würdigung der zugrunde liegenden Problematik, ist in den meisten Fällen wenig Erfolg versprechend oder führt zur Verlagerung dysfunktionaler Muster.
Beziehungsarbeit und motivierende Gesprächsführung
Unabhängig vom zugrunde liegenden Störungsbild oder von vorhandenen Komorbiditäten empfiehlt Referentin Ulrike Sanwald, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, im Umgang mit Betroffenen:
- einen sicheren verbindlichen Rahmen bieten
- sichere Beziehungsangebote
- Gespräche strukturieren
- Aufträge klären und ggf. immer wieder auch hinterfragen
- bei Irritationen nachfragen/nach Irritationen fragen
- Ressourcen/Kompetenzen würdigen
- ehrliches Interesse zeigen
Als Gesprächstechnik mit den Klientinnen und Klienten sei die «motivierende Gesprächsführung» sehr hilfreich. Diese ist darauf ausgerichtet, dass jeder Mensch über ein Veränderungspotenzial verfüge, Tempo und Ziel des Prozesses jedoch immer das der Klientin/des Klienten sein muss. Die Phasen der Veränderung umfassen den Wandel von der Absichtslosigkeit zur Absicht, Vorbereitung, Handlung, Aufrechterhaltung. Ambivalenz ist erwünscht und wichtiger Teil des Prozesses. Ebenso werden «Rückfälle» – im therapeutischen Kontext vermehrt auch «Vorfall» oder «Trinkereignis» genannt –bereits im Vorfeld mitgedacht und dienen als wichtige Informationsquelle bei der erneuten Anpassung von Tempo und Zielen.
Schliesslich hatten die Teilnehmenden des Workshops Gelegenheit, die Inhalte anhand von Übungen, angelehnt an typische Herausforderungen in ihrem Praxisalltag, in Kleingruppen zu reflektieren und anschliessend mit Ulrike Sanwald und im Plenum zu teilen.